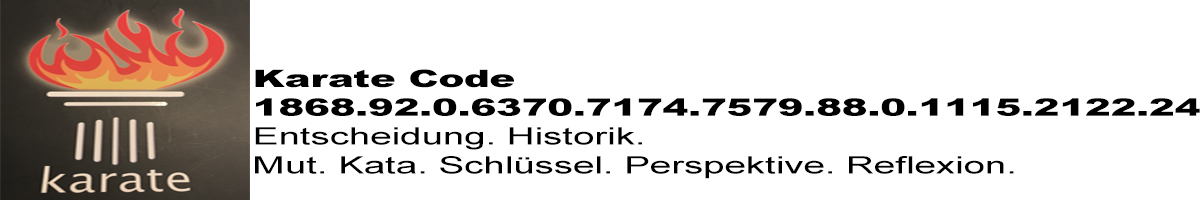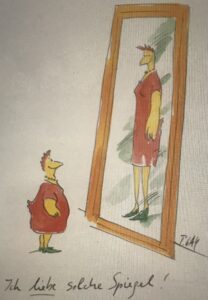Nischen-„Welt- und Europameisterschaften“
🇨🇭 Roland Zolliker
Als in den 50iger Jahren einige weitsichtige Karateka einen gemeinsamen Weltverband aller Stilrichtungen gründen wollten, waren sie einsame Rufer. Jahre später wurde auf französische Initiative 1965 die European Karate Union EKU (heute European Karate Federation EKF) und 1970 die World Union of Karate Do Organisations WUKO, die heutige World Karate Federation WKF, gegründet. Massgebend daran beteiligt war der Begründer des Karate in der Schweiz, der Walliser Bernard Cherix, der bis 1976 Vizepräsident der EKU blieb.
Die erste internationale Anerkennung als offizieller Fachverband erfolgte 1975 durch die Association Générale des Fédérations Internationales de Sport (AGFIS), heute SportAccord International Sports Federation. Am 6. Juni 1985 folgte das Internationale Olympische Comité (IOC) erstmals, am 17./18. März 1999 definitiv und bezeichnete die WKF als einzige offizielle Sportorganisation mit der Verpflichtung auf ein einheitliches Wettkampfreglement für alle Stilrichtungen. Dies analog anderen Sportarten, wo die Regelsysteme auch weltweit Gültigkeit haben. Der IOC-Entscheid zu Gunsten der WKF war die logische Konsequenz der Differenz zwischen einem offenen-liberalen System und dem abgeschottet-eigensinnigen Stilsystem anderer Verbände.
Jetzt konnte das Karate seinen Anspruch auf Öffentlichkeit und staatliche Förderung legitimieren. Dies, weil nun mit der WKF eine Organisation bestand, in der alle Stilrichtungen an einem Anlass gleichberechtigt um Welt-, Kontinental- und nationale Titel kämpfen können. Die olympische Idee strebt das Primat eines universellen Strebens nach Exzellenz anstatt des Primats eines Strebens nach „Diversifizierung“ von gleichen Sportdisziplinen.
Die weltweite Integration der Stile und ihrer nationalen Verbände in die WKF war ein grosser Erfolg 2016 auf dem Weg zur globalen Anerkennung als gleichwertige olympische Kampfsportart wie Ringen, Judo und Taekwondo. Leider ist dies bis jetzt die einzige olympische Teilnahme.
Dieser Entwicklungsschritt war der Gang in die Normalität, ohne jeglichen Verlust der bisherigen inneren Stil-Substanz. Die Stile bleiben als unverzichtbares traditionell-historisches Fundament bestehen und garantieren die nachhaltige technische Förderung des Karate. Zudem ist es der Respekt für die grossen Lehrer des Karate wie Gichin Funakoshi (Shotokan, 1868 – 1957), Chojun Miyagi (Goju-Ryu, 1888 – 1953), Kenwa Mabuni (Shito-Ryu, 1893 – 1957), Hironori Otsuka (Wado-Ryu, 1892 – 1982).
Eine Disziplin, die unter dem gleichen Namen, mehrere „Welt- und Europameisterschaften“ durchführt, kann nicht ernst genommen werden. So anerkennt und richtet auch Swiss Olympic Erfolgsbeiträge nur für Titel und Medaillen die an den Turnieren der WKF (EM/WM) errungen werden. Auch das Bundesamt für Sport richtet nur Subventionen an die SKF aus.
Die Fokussierung auf Nischen-„Meisterschaften“ (nach einer Studie der KPMG International 2015 repräsentiert die WKF 96.8 % des in Verbänden organisierten Welt-Karate) und nicht Zulassung an die Turniere der WKF/EKF/SKF ist nach unserem Dafürhalten ein Betrug an jungen Athletinnen und Athleten, die nichts über die Ordnung des Sports kennen, viel Zeit und Energie investieren und Titel erringen, die wenig Wert haben. Ihre Publikation und Gleichstellung mit dem WKF-Karate kann durchaus als unlauterer Wettbewerb eingestuft werden.
Homo narzissmus karategenisis
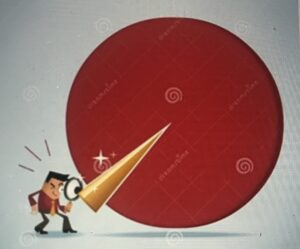 Wenn ein am Sportbetrieb teilnehmender Karatelehrer sich für die Leistungen seiner Schüler zu wenig beachtet fühlt, von den Schiedsrichtern negative Rückmeldungen erhält, dann arbeitet er in der Regel noch härter, noch intensiver um den Anschluss an die Besten zu finden. Nicht so die „wahren“ Meister. Je schwerer sie den Mangel empfinden, desto entschlossener tun sie alles, um anerkannt zu sein, gründen eigene Organisationen zum Abfeiern ihrer Grandiosität. So können sie ihren gestörten Selbstwert korrigieren, ihr Versagen der Vergangenheit übergeben. Kommt zu dieser sportlichen Selbstwerterhöhung noch die Lizenz zum Geldverdienen durch eigene Mitgliedermarken und –Ausweise, zweifelhafte Gradverleihungen, erreicht die Perversion des Karatedo ihren Höhepunkt.
Wenn ein am Sportbetrieb teilnehmender Karatelehrer sich für die Leistungen seiner Schüler zu wenig beachtet fühlt, von den Schiedsrichtern negative Rückmeldungen erhält, dann arbeitet er in der Regel noch härter, noch intensiver um den Anschluss an die Besten zu finden. Nicht so die „wahren“ Meister. Je schwerer sie den Mangel empfinden, desto entschlossener tun sie alles, um anerkannt zu sein, gründen eigene Organisationen zum Abfeiern ihrer Grandiosität. So können sie ihren gestörten Selbstwert korrigieren, ihr Versagen der Vergangenheit übergeben. Kommt zu dieser sportlichen Selbstwerterhöhung noch die Lizenz zum Geldverdienen durch eigene Mitgliedermarken und –Ausweise, zweifelhafte Gradverleihungen, erreicht die Perversion des Karatedo ihren Höhepunkt.
Es ist aber auch medizinisch zu argumentieren. Das Gefühl dieser Meister, dass ihre Schüler nicht genügend gut bewertet werden, führt zu einer emotionalen Unterversorgung, dem Ausbleiben der, ihrer Meinung nach zu Unrecht, nicht zugesprochenen Anerkennung. Daraus resultiert tiefer Schmerz, besonders in den Kata-Disziplinen, der Sturz in die Depression. Wird dieser Zustand dauernd verdrängt, entsteht eine niedergeschlagene Stimmung, schwere neurotische Störungen die das ganze Umfeld erfassen und beeinträchtigten.
Nicht so die Spezies des Homo narzissmus karategenisis. Sie stellen ihr Selbstwertgefühl durch ihre neu gegründeten oder erschlossenen Reiche wieder her, gesunden in kürzester Zeit, entlasten Krankenkassen, benötigen weder Therapiestationen noch betreute Wohngemeinschaften. Wenn ihre Genialität auch hier tiefe Risse erhält, finden sie wieder eine neue Organisation, nach dem Motto: Lieber der Erste im Dorf, als der Letzte in der Stadt. Damit liegen sie auf einer Linie mit Cäsar, der beim Anblick einer kleinen Stadt in den Alpen ausgerufen habe: »Ich möchte lieber der Erste hier als der Zweite in Rom sein.« Also lieber die wichtigste Funktion in einem kleinen Rahmen zu haben, als eine untergeordnete Rolle in einem grossen zu spielen.
Einige verharren bis zum Schluss ihrer Tage in ihren Nischen-Organisationen. Andere scheitern auch hier (und enden im übertragenen Sinn wie Cäsar) und kommen schliesslich da an, wo alle Narzissten enden: In Vereinsamung, Ausgrenzung als gescheiterte Existenzen, für die nur die eigenen Maßstäbe und Regeln gelten.
Es gibt keine Einwände gegen die verschiedenen Interpretationen von Stilrichtungen und Durchführung entsprechender nationaler und internationaler Meisterschaften mit der Bezeichnung Welt-oder Europacups oder die “WM-EM“ Bezeichnung mit dem klaren Zusatz Shotokan, Goju-Kai, Goju-Ryu oder Wado-Kai. Die SKF „beherbergt“ in der SKF selber über 20 Stilrichtungen unterschiedlichster Prägung.
Es ist jedoch ganz klar gegen Personen vorzugehen, die sich nicht den von den jeweiligen Nationalen Olympischen Komitees anerkannten Verbänden anschliessen, an eigenen Nischen-„Welt- und Europameisterschaften“ starten, und sich dann medial mit den offiziellen Titelträgern oder Medaillengewinnern auf eine Stufe stellen. Dazu gehören auch jene Athletinnen und Athleten, die an WKF- und SKF-Turnieren scheitern und sich dann als „Ausgleich“ mit Titeln und Medaillen an den vorerwähnten Meisterschaften schadlos halten.