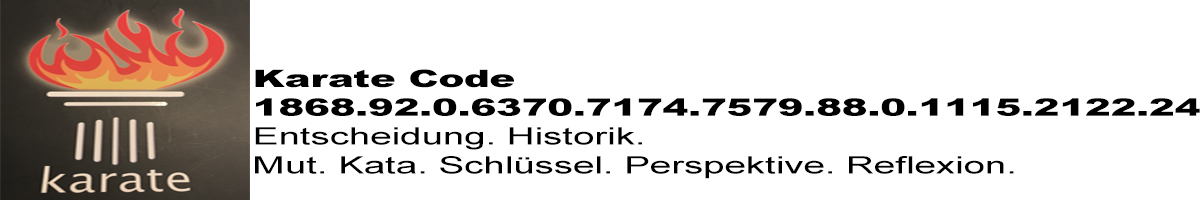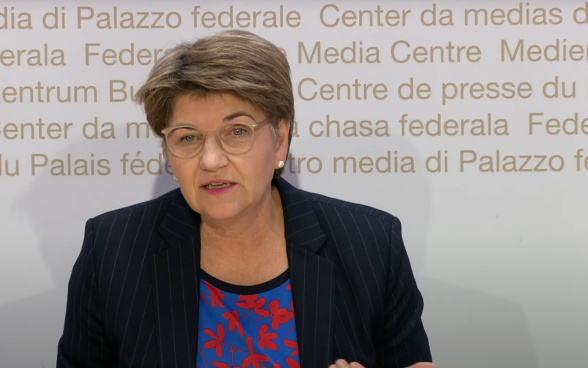Hybride Kriegsführung im Sport
🇨🇭 Roland Zolliker
 „Wir sind in der harten Welt im Sport mit dem aktuellen «Ein-Platz-Prinzip“.
„Wir sind in der harten Welt im Sport mit dem aktuellen «Ein-Platz-Prinzip“.
Um Ziele zu erreichen, setzen Interessensgruppen auch im Sport auf eine Kombination von verschiedenen Instrumenten. Der «hybride Krieg» war schon immer ein Teil der Karatewelt. Er ist der Oberbegriff für alle Arten von Einflussnahme in der «Grauzone» zwischen Tatami und «Management». Die Einsetzung von Machtinstrumenten ist nichts Neues. Es werden so Ergebnisse angestrebt, um Erfolge auf den Tatamis zu verhindern oder im Nachhinein zu «korrigieren». Wenn man nicht dagegen vorgeht, landet man auf der Speisekarte der Aggressoren.
Im Karatesport zählen folgende Ebenen zum hybriden Mix:
Management:
1-Macht über Reglemente
2-Doppelmandate
3-Wahl/Abwahl Personen
4-Verhinderung/Dezimierung Leistungseinheiten
5-Steuerung Traktanden (inhaltlich, zeitlich)
6-Hierarchischer Druck auf untere Ebenen, Ausnutzung von Machtgefällen, insbesondere Danstufen
7-Instrumentalisierung
8-Desinformation
9-Halbwahrheiten gegenüber Partnern / Behauptung angeblicher Aussagen von verantwortlichen Personen
10-Missbrauch von internationalen Funktion auf nationaler Ebene
11-Sponsoring (individuelle Rabatte, Geschenke, Einladungen)
12-Abwerbung Dojos
13-Athleten als „Nestbeschmutzer“ zu bezeichnen die sich bei Swiss Sport Integrity melden
Konkret:
1-keine
• Meldung Talentsichtungstag, damit keine Aufnahme in National- oder Stützpunktkader
• Berücksichtigung Spitzensport-RS
• Anträge Swiss Olympic Bronze, Silber oder Goldcard
• Aufnahme Förderpool, damit fehlende finanzielle Unterstützung
2-Reglemente mit «subjektiven» Selektionskriterien zu Gunsten der Kaderverantwortlichen
Kommentar:
Es gilt zu analysieren
1-welche Personen, in welcher Form an einer Entscheidung beteiligt sind und welche Personen zu ihrem Nachteil betroffen sind
2-welche Entscheide mit welchen Variablen vor der formalen Sitzung getroffen werden
3-wer welche Interessen (u.a. auch finanziell) verfolgt und welche Beziehungen, Einflussnetze aktiv sind
4-wer verhindern will, dass ein Thema überhaupt auf die Agenda kommt.
5-wer mit Desinformation/Halbwahrheiten eigene «Wahrheiten» durchsetzen will und die ethischen Kriterien des Sports aussen vorlässt
Es fallen vor allem jene Personen Täuschungen anheim, die wenig bis keine Ahnung vom Leistungssport haben, über ein großes allgemeines Informationsdefizit verfügen und auch kein kritisches Bewusstsein für den Leistungssport entwickelt haben. Ihnen kann man fast alles erzählen. Sie sind eine weiche Knetmasse in den Händen der Instrumentalisten.
Tatami:
1-Psychomachtspiele vor, während, nach Turnier, Training
2-Kumite im physischen Grenzbereich
3-subtiles oder offenes Mobbing
4-Schiedsrichter „Schulung durch Interessengruppen vor dem Turnier, Austausch während dem Turnier“
5-Funktionäre hinter den Stühlen von Schiedsrichtern
Leistungssporttrainer:
1-Abwerben von Nachwuchsathleten mit der gezielten Schwächung deren Dojos
2-Abwertende Bemerkungen direkt, zum Umfeld der Konkurrenten der eigenen Athleten
Soziale Medien:
1-die «öffentliche Meinung» so beeinflussen, dass die eigentliche Wahrheit «aussen» vor bleibt.
Kommentar:
Durch die heutigen Instrumente wie WhatsApp, Facebook, Instagramm und Co. nimmt die Geschwindigkeit, der Umfang und die Intensität laufend zu. So kann heute innert kürzester Zeit grosser Schaden, bis zu Gewaltandrohungen, angerichtet werden.
Umfeld:
1-abwertende Äusserungen
2-Drohungen mit Anwälten
3-Anbietung von „win-win Situationen“ mit Deals
Die Einrichtung des Ethik-Status ist ein starkes Indiz dafür, dass politische Entscheidungsträgerinnen und -träger heutige Zustände im Sport als erhebliche Gefahr wahrnehmen und verbindliche Vorgaben für ethisches Verhalten festlegen. So formuliert vom Bundesrat, 25. Januar 2023, Foto Frau Bundesrätin Viola Amherd, wie folgt:
Der Bundesrat stärkt den Schutz insbesondere von jungen Athletinnen und Athleten vor Gewalt, Diskriminierung und psychischen Persönlichkeitsverletzungen. In Zukunft hängen Finanzhilfen an Sportorganisationen von deren Anstrengungen zugunsten des fairen und sicheren Sports ab. Das Massnahmenpaket umfasst auch die Verankerung einer unabhängigen nationalen Melde- und einer Disziplinarstelle. Der Bundesrat hat die entsprechenden Verordnungsänderungen in seiner Sitzung vom 25. Januar 2023 beschlossen und auf den 1. März 2023 in Kraft gesetzt. Sie ist Teil des Projekts «Ethik im Schweizer Sport», das Bundesrätin Viola Amherd im November 2021 angekündigt hatte.
Der Bundesrat toleriert keine Misshandlungen und Einschüchterungen von Athletinnen und Athleten. Verschiedene Vorfälle in den letzten Jahren haben gezeigt, dass die bestehenden Vorgaben rechtlich zu wenig bindend sind, um bei Vorfällen Sanktionen wie beispielsweise Subventionskürzungen durchzusetzen. Mit der Anpassung der Sportförderungsverordnung hat der Bundesrat nun diese Möglichkeiten geschaffen. Die Basis hierzu bildet das Ethik-Statut, welches das Schweizer Sportparlament, auch die SKF, Ende 2021 verabschiedet hat. Sportverbände und -vereine müssen diese Bestimmungen erfüllen, wenn sie Finanzhilfen des Bundes beanspruchen. Dabei verpflichten sie sich, Massnahmen zum Schutz von Athletinnen und Athleten zu ergreifen – beispielsweise vor Gewalt, Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, Diskriminierung und psychischen Persönlichkeitsverletzungen.
Meldestelle untersucht und Disziplinarstelle sanktioniert Verstösse
Ein Kernelement der Vorlage ist die rechtliche Verankerung der unabhängigen nationalen Meldestelle und der Disziplinarstelle. Die von der Stiftung Swiss Sport Integrity betriebene Meldestelle ist bereits seit Anfang 2022 in Betrieb. Die Stiftung untersucht Meldungen von allfälligem Fehlverhalten oder von Missständen und beantragt bei Verstössen gegen das Ethikreglement Sanktionen bei der Disziplinarstelle von Swiss Olympic. In Fällen von strafbarem Verhalten erstattet sie Meldung an die Strafverfolgungsbehörden. Der Bund unterstützt den Betrieb der Meldestelle aktuell mit 1.02 Millionen Franken pro Jahr.
Vorgaben an die Good Governance
Die revidierte Sportförderungsverordnung legt im Weiteren die Anforderungen an eine zeitgemässe Verwaltungsführung von Sportorganisationen fest. Namentlich sind dies Regeln betreffend die Transparenz, den Umgang mit Interessenkonflikten, eine ausgeglichene Geschlechtervertretung und eine Amtszeitbeschränkung für Leitungsorgane. Analog zu den bundesnahen Betrieben legt der Bundesrat neu auch bei Sportorganisationen fest, dass beide Geschlechter mit mindestens je 40% in den Leitungsorganen (Präsidien und Vorstände) besetzt sind. Allerdings strebt er dieses Ziel mit Augenmass und unter Berücksichtigung des grossen Stellenwerts der Ehrenamtlichkeit im Schweizer Sport an. So sollen verbindliche Quoten ausschliesslich für den Dachverband Swiss Olympic sowie nationale Sportverbände gelten. Wer das Ziel noch nicht erfüllt, soll dies begründen und aufzeigen, mit welchen Massnahmen er dies künftig zu erreichen sucht. Für alle weiteren Sportorganisationen wie regionale Verbände oder Vereine soll Swiss Olympic eine Branchenlösung erarbeiten, welche die Förderung der ausgewogenen Geschlechtervertretung unterstützt, wobei nicht zwingend Quoten verlangt werden.
Damit berücksichtigt der Bundesrat ein Hauptanliegen aus der Vernehmlassung zur Verordnungsrevision. Pragmatisch soll auch die Frage der Amtszeitbeschränkung angegangen werden: Der Bundesrat empfiehlt eine maximale Amtsdauer von 12 Jahren, überlässt die definitive Regelung aber Swiss Olympic.
Die Verordnung sieht Übergangsfristen insbesondere für die Umsetzung der Vorgaben bei der Good Governance vor. Nationale Verbände haben diese ab 1. Januar 2025 und Sportvereine, die ausschliesslich Subventionen für ihre J+S-Kurse und -Lager beziehen, ab 1. Januar 2026 umzusetzen.
Projekt «Ethik im Schweizer Sport»
Die verabschiedete Verordnungsrevision bildet den rechtlichen Teil des Projekts «Ethik im Schweizer Sport», das Bundesrätin Viola Amherd im November 2021 im Zusammenhang mit einer externen Untersuchung nach Vorkommnissen in der Rhythmischen Gymnastik angekündigt hatte. Das Projekt wurde Anfang 2022 vom Bundesamt für Sport BASPO und dem Sportdachverband Swiss Olympic lanciert und hat zum Ziel, ethische Grundsätze auch in der Ausbildung von Fachpersonen, in der Nachwuchsförderung und im Bereich der Elternmitarbeit zu implementieren. Diese Arbeiten sind auf allen Ebenen im Gang und werden im laufenden Jahr fortgesetzt.
Konklusion
Die hybriden Bedrohungen sind ernst zu nehmen. Sie sind eine gezielte Kombination aus «sportlichen, reglementarischen, strukturellen» Massnahmen. Verdeckt und offen. Dies ist eine erhebliche Gefahr für die Karatewelt, die sich immer wieder exziplit auf ethische Standards, Code of Conduct, Compliance, d.h. Rechtstreue, Regelkonformität beruft.